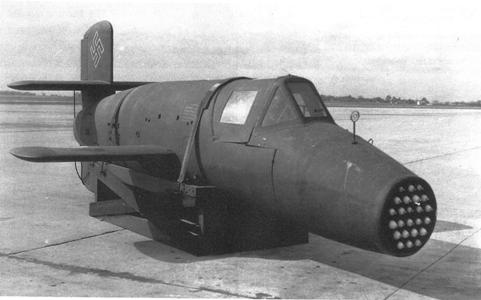Die letzten zwei Wochen haben wichtige, scheinbar unabhängige Zahlen und Informationen darüber gebracht, wie sich die Wirtschaft im ersten Halbjahr 2024 entwickeln wird.
Hier sind drei provokative Gründe: Slowakische Arbeitnehmer arbeiten weitaus mehr Stunden als ihre Kollegen in fortgeschritteneren Volkswirtschaften; Die Arbeitsproduktivität in unserem Land erreicht nicht ihren Höhepunkt. Und um den Brand in den öffentlichen Finanzen rechtzeitig zu löschen, müssen wir aus einem vielfältigen Sparprogramm wählen. Auf den ersten Blick scheint es, dass diese drei Informationen nur durch ihren bitteren Geschmack verbunden sind. Allerdings hängen sie eng zusammen, wie fast alles in der Wirtschaftswissenschaft.
Unsere Leute arbeiten weder wenig noch schlecht. Warum ist die Produktivität niedrig?
Der durchschnittliche Erwerbstätige unserer Volkswirtschaft arbeitete im ersten Halbjahr 2024 rund 820 Arbeitsstunden. In Deutschland (das hier als Modell der fortgeschrittenen europäischen Wirtschaft dienen soll) waren es 675 Stunden, also 145 Stunden weniger in sechs Monaten. Schaut man auf die vergangenen Jahre, bestätigt sich dies: Ein Arbeitnehmer arbeitet hier rund 23 Stunden mehr im Monat als sein deutscher Kollege. Unser Arbeiter tut also nicht wenig, ganz im Gegenteil. Allerdings beträgt die Arbeitsproduktivität (also die von einem Arbeitnehmer geschaffene Wertschöpfung) je nach Messung nur 52-55 % der deutschen. Und schlimmer noch, es war 2022 und 2021 dasselbe.
Kurzum: Wir holen in der Produktivität nicht mehr mit der deutschen Produktivität auf. Wir haben ihn immer eingeholt, in den letzten zehn Jahren hatten wir mehrmals Probleme. Und das sind sehr schlechte Nachrichten im Hinblick auf die Konvergenz der Lebensstandards. Es ist üblich, dass weniger entwickelte Volkswirtschaften mehr Stunden arbeiten als stärker entwickelte Volkswirtschaften. Genau dadurch wird das Handicap der am wenigsten entwickelten Länder verringert. Nehmen Sie das Beispiel der Slowakei: Die sogenannte Stundenproduktivität (die Wertschöpfung eines Arbeitnehmers in einer Stunde) erreicht nur 43 % des deutschen Niveaus. Würde ein slowakischer Arbeitnehmer „nur“ so viele Stunden arbeiten wie ein deutscher Arbeitnehmer, läge seine persönliche Produktivität (nicht stündlich, sondern persönlich) auf dem Niveau von 43 % der seines deutschen Kollegen.
Indem unser Mitarbeiter im Durchschnitt mehr Stunden arbeitet als sein deutscher Kollege, überwindet er einen Teil dieses Handicaps und erreicht das Niveau von 55 %. Dies mildert die Verzögerung des Niveaus unserer Wirtschaft sowie die Verzögerung des Lohnniveaus etwas. Kurz gesagt, Länder mit geringer Stundenproduktivität neigen dazu, einen Teil dieser Lücke durch den Einsatz von mehr Arbeitsstunden auszugleichen. Aber das geht offensichtlich nur bedingt.
Kurzum: Wir holen in der Produktivität nicht mehr mit der deutschen Produktivität auf. Wir haben ihn immer eingeholt, in den letzten zehn Jahren hatten wir mehrmals Probleme. Und das sind sehr schlechte Nachrichten im Hinblick auf die Konvergenz der Lebensstandards.
Und das bringt uns zur nächsten Frage: Warum schließen wir bei der Stundenproduktivität nicht mit den fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf? Es ist auch nicht so, dass der deutsche Arbeiter doppelt so schnell arbeitet. Es liegt vielmehr daran, dass es andere Tätigkeiten ausführt und an einem anderen Produkt arbeitet. Er betreibt nicht mehr körperliche Betätigung, aber er übt Aktivitäten aus, die wertvoller sind und einen größeren Wert haben. Es arbeitet beispielsweise an der Produktion teurerer Güter und führt komplexere Vorgänge mit teurerer und fortschrittlicherer Technologie durch. Natürlich nicht jeder, aber im Durchschnitt.
Es gibt Tipps zur Verbesserung der Produktivitätshebel, die manchmal wie Klischees wirken (aber sie sind nicht falsch, wir reden nur schon lange darüber, ohne sie umzusetzen). Dazu gehören höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die Förderung von Innovationen oder Investitionen in neue Technologien. Zu diesem scheinbar banalen Hinweis sollte hinzugefügt werden, dass nicht alle dieser Medikamente automatisch wirken. Die Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und technologischem Fortschritt allein werden keine Wirkung haben, wenn Sie ihre Produktion nicht infizieren.
Ein kleiner Vergleich: In der Ausstattung des durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmers (in seiner Ausstattung an Maschinen, Werkzeugen, Computern, sonstigen Betriebsvermögen) steckt auch Forschungs- und Entwicklungswissen im Wert von 23.941 Euro (Jahr 2021). Unser Mitarbeiter verfügt über ein für die Produktivität sehr wichtiges Vermögen in Höhe von 2.609 Euro.
Offenbar gelangen die Ergebnisse geistiger Tätigkeit nicht ausreichend in den Produktionsprozess. Dafür braucht es einen Unternehmensstrategen, der es versteht, ein Unternehmen mit solchen Maßnahmen in globale Produktionsketten „einzubinden“, dass er auch dieses Wissen über Wissenschaft, neue Technologien und Innovationen nutzen kann. Und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem eine höhere Produktivität keinen superschnellen Arbeiter erfordert, sondern vielmehr eine andere Art seiner Tätigkeit.
Keine Axt, bitte!
Selbst das heißeste Wirtschaftsthema des Tages, die Expertenwährung zur Konsolidierung der Regierung, wäre nicht so aktuell, wenn es nicht bereits ein chronisches Produktivitätsproblem gäbe. Geringe Produktivität bedeutet, dass nicht genügend dauerhafte Ressourcen geschaffen werden, um den Bedarf des Unternehmens zu decken. In Kombination mit den langfristigen Expansionsbestrebungen der Politiker und regelmäßigen Haushaltslecks (bei Krisen, Schocks oder Wellen verstärkter „Großzügigkeit“ von Politikern) bedeutet dies, dass schmerzhafte Konsolidierungen, Einsparungen und Kürzungen erforderlich sind.
Und je drastischer und unempfindlicher die Kürzungen sind, desto ausgeprägter kann die Abschwächung des Wirtschaftswachstums und der Produktivitätsentwicklung ausfallen.
Premierminister Ľudovít Ódor sprach bei der Darstellung des Rätsels der Sparmaßnahmen über den Unterschied zwischen dem Schneiden mit einem Skalpell jetzt und dem Schneiden mit einer Axt später. Diese Axt bedeutet nicht nur unmittelbare und grausame soziale Auswirkungen, es besteht (fast sicher) die Gefahr, sogar das zu schädigen, was wir nicht schwächen wollen: in diesem Fall die Motoren der Produktivität. Deshalb bevorzuge ich das Skalpell.

Freiberuflicher Unternehmer. Web-Pionier. Extremer Zombie-Evangelist. Stolzer Bier-Befürworter