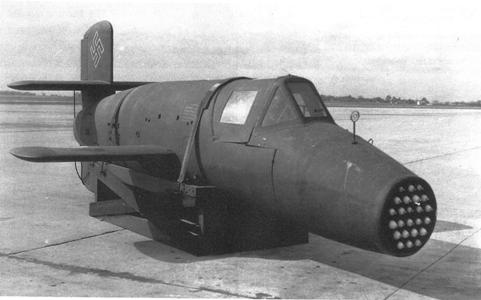Der vom Architektenduo Gustav Düsing und Max Hacke entworfene Studienpavillon für Studierende der Fakultäten der Technischen Universität Braunschweig ist Gewinner des renommierten Mies van der Rohe-Preises 2024.
Seit der Pandemie entwickelt sich die akademische Welt dynamisch. Lehrveranstaltungen und Seminare finden überwiegend online statt, Studierende entwickeln sich fast ausschließlich in der digitalen Welt und künstliche Intelligenz verändert die bisher gewohnte Form des Unterrichts. Der Studienpavillon an der ältesten technischen Universität Deutschlands ist ein Projekt, das auf unvorhersehbare Entwicklungen reagieren kann und versucht, die Frage zu beantworten, welche Rolle der Universitätscampus in Zukunft spielen könnte.
Der Studienpavillon der Technischen Universität Braunschweig ist ein innovativer zweigeschossiger Baukörper, der Studierenden aller Fakultäten Lernräume bieten soll. Der Pavillon befindet sich im zentralen Bereich des Universitätscampus, im nördlichen Teil der Stadt Braunschweig. Es entsteht am Ufer der Oker, neben dem historischen Hauptgebäude der Universität und dem Hauptuniversitätsplatz und verbindet so die bereits bestehenden Fußgängerwege im Campusbereich.


Das Ziel der Architekten bestand darin, einen multifunktionalen Raum zu schaffen, der für alle Studierenden zugänglich ist, einen Raum, der eine moderne Lernumgebung bietet und sich optisch in die bereits auf dem Campus vorhandenen Typologien integrieren lässt. Das Ergebnis ist ein offener und ausreichend flexibler Raum, der sich an die Studierenden und ihre Bedürfnisse anpasst. So können sie alleine oder in Gruppen arbeiten, Seminare, Konferenzen veranstalten oder einfach nur entspannen.
Das Gebäude ist ohne Unterteilungen, ohne erkennbare Hierarchien oder Barrieren gestaltet. So interpretieren Architekten Offenheit in der zwischenmenschlichen Kommunikation, auch zwischen verschiedenen Studiendisziplinen. Damit widersprechen die Räume deutlich dem traditionellen Modell des Wissenserwerbs, also der unidirektionalen Informationsvermittlung vom Lehrer zum Schüler, beispielsweise in klassischen Hörsälen oder geschlossenen Klassenräumen.
Der Pavillon ist eine multifunktionale Kulisse, die den Studierenden völlige Freiheit bei der Entscheidung gibt, wie sie den Raum nutzen möchten. Architekten haben Bedingungen geschaffen, in denen Studierende gemeinsam lernen, Gemeinschaften bilden und sich nicht auf ihr Fachgebiet beschränken können.
Anstelle von festen Trennwänden oder klar definierten Böden schufen die Architekten sogenannte Zonen – eine Art Plattformen, die die Studierenden über die Treppe oder durch den entsprechenden Eingang erreichen. Es ist möglich, einen großen Sozialbereich über zwei Etagen oder kleinere, intimere Bereiche zu nutzen. Diese flexible Gestaltung macht das Gebäude reaktionsfähig, da es sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden anpassen kann.
Der Studienpavillon zeichnet sich außerdem durch eine vollständig verglaste Fassade aus, dank der das Tageslicht in jeden Winkel gelangt und die Innenräume mit den Außenräumen verbindet. Schallabsorbierende Vorhänge, Teppiche und Akustikdecken sorgen für eine angenehme Akustik im Raum und schaffen eine Gesprächsatmosphäre.


Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, die zu 80 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt, kombiniert mit Bodensensoren zur Kühlung während der Sommerhitze.
Ein drei Meter hohes Vordach über den Balkonen beschattet die Fassade im Sommer und profitiert im Winter, wenn die Sonne tief steht und die Bäume keine Blätter haben, von der Sonne. Auch studentische Arbeiten an Laptops tragen zu passiven Wärmegewinnen bei. Das Gebäude wird dank Flügelfenstern und einer verglasten Kuppel natürlich belüftet.
Das Gebäude besteht aus einer innovativen Stahl-Holz-Hybridkonstruktion. Es handelt sich um eine modulare Struktur, deren Tragkonstruktion aus Balken und Stützen besteht, die im Raster von 3 x 3 m angeordnet sind.
Die Balken und Säulen selbst bestehen aus einem Hohlprofil mit einem Querschnitt von 10 × 10 cm, in dem Steckdosen, Beleuchtung im Obergeschoss und die notwendige Kabelverteilung versteckt sind. In die Balkenrahmen werden gerillte Holzplatten eingelegt, die lediglich verschraubt werden. Das Bauwerk kann somit komplett abgebaut, versetzt und anschließend an einem neuen Standort errichtet werden. Es lässt sich aber auch durch das Hinzufügen weiterer Fliesen problemlos verdichten.
Mit diesem Projekt unterstützen die Architekten das Prinzip der Zirkularität in der Architektur, das Gebäude muss nicht abgerissen werden, es muss lediglich abgebaut, verschoben und in gleicher oder völlig anderer Form wieder zusammengesetzt werden. So recyceln sie nicht nur die Baumaterialien selbst, sondern auch ganze Architekturelemente, zum Beispiel Fassadenplatten, Treppen und Podeste. Der Studienpavillon wird so zu einem Beispiel dafür, wie die Zukunft des Bauens aussehen könnte.
Studiensaal der Technischen Universität Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland
Architekten: Gustav Düsinga Max Hacke
Projektsponsor: Technische Universität Braunschweig
Bereich: 1000m2
Kosten: 5,2 Millionen Euro
Fertigstellung: Januar 2023
Der Artikel wurde in der Zeitschrift ASB 5/2024 veröffentlicht

Freiberuflicher Unternehmer. Web-Pionier. Extremer Zombie-Evangelist. Stolzer Bier-Befürworter