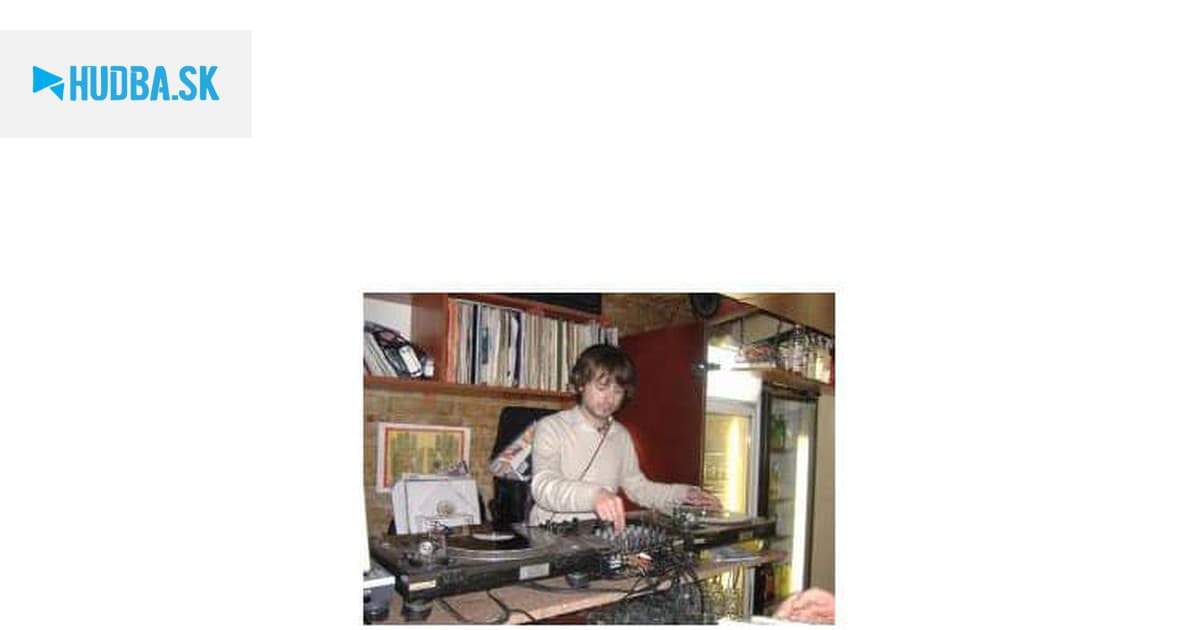Sie arbeitete hart im Training, um die höchste Stufe der Olympiamedaillengewinnerin erreichen zu können. Ihr großer sportlicher Traum ging jedoch nicht in Erfüllung, denn sie war eine der ersten, die den Beginn der antisemitischen Maschinerie der Nazis spürte. Die ehemalige große deutsche Sportlerin jüdischer Herkunft war Margaret Bergmann-Lambert. Ihre Nichte Doris Bergmann sagte der New York Times, sie sei am Dienstag im Alter von 103 Jahren gestorben.

Foto: SITA/AP, Seth Wenig
Margaret Bergmann-Lambert auf einem Archivfoto vom Mai 2010. Die herausragende ehemalige deutsche Vorkriegssportlerin starb im Alter von 103 Jahren in den USA.
Bergmann (wie sie sich selbst nannte, als sie Single war) erlebte ihren ersten schlimmen Kontakt mit dem Nationalsozialismus kurz nach der Machtübernahme Adolf Hitlers, als sie in ihren Zwanzigern war. Eine vielversprechende Hochspringerin wurde aus einem Sportverein geworfen, weil sie Jüdin war. Seine Eltern schickten ihn deshalb nach Großbritannien. Auch die Tatsache, dass die Nazis Bergmanns Bewerbung an der Universität ablehnten, war ein Zeichen dieser Entscheidung.
Als die Frist für die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin näher rückte, drängte Deutschland, das ihre Eltern bedroht hatte, sie zur Rückkehr in ihr Heimatland. Dies resultierte aus dem Versuch der Nazis, sich in einem besseren Licht zu zeigen, damit es während der Olympischen Spiele nicht den Anschein erweckte, dass es den Juden so schlecht ginge.
Sie wollte Hitler mit einer außergewöhnlichen Leistung in Verlegenheit bringen
Einen Monat vor den Olympischen Spielen stellte Bergmann in Stuttgart den deutschen Hochsprungrekord ein. „Zwei Wochen vor Beginn der Spiele teilte ihr der Deutsche Sportbund jedoch mit, dass man sie aufgrund schlechter Leistungen nicht in die Berliner Mannschaft aufgenommen habe. Anschließend hat er seinen Namen von der Aufnahmeliste gestrichen“, sagte der Sender Deutsche Welle.
Bergmann konnte diese absurde Entscheidung kaum ertragen: „Es war ein schrecklicher Schock, weil ich die Beste war“, betonte sie 2015 gegenüber der Zeitung Newsday. Sie war in hervorragender Form, in Berlin wäre sie die Favoritin auf den Gewinn der Goldmedaille. „Ich wollte an den Olympischen Spielen teilnehmen, um Hitler in Verlegenheit zu bringen und zu zeigen, was eine Jüdin erreichen kann. Es sollte meine Rache sein. Ich wusste, dass ich auf dem Weg zu Gold war“, sagte sie 2009 dem Daily Telegraph.
Was Bergmann außerdem nicht durfte, tat ein anderer jüdischer Sportler. Ibolya Csáková, eine ungarische Jüdin, gewann Gold im Hochsprung in Berlin.
Der Ekel vor der antijüdischen Ungerechtigkeit vor den Olympischen Spielen und die Angst vor einem wachsenden Antisemitismus veranlassten Bergmann zur Emigration. 1937 zog sie in die USA, wo sie die Staatsbürgerschaft erhielt und Bruno Lambert heiratete, der ebenfalls aus Deutschland floh. Der große Hochspringer gewann zweimal die US-Leichtathletikmeisterschaften.
Sie vergab den Deutschen nach mehr als einem halben Jahrhundert
Der Widerstand gegen Nazi-Deutschland war bei Bergmann so stark, dass sie in den Vereinigten Staaten ihren ursprünglich deutsch klingenden Vornamen, Gertel, in Margaret änderte. Als die Nazis im September 1939 in Polen einmarschierten, verlor sie das Interesse am Spitzensport, und nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde ihr klar, dass die Olympischen Spiele zu früh nicht stattfinden würden. (Die Spiele fanden 1940 und 1944 nicht statt.)
Es war ein schrecklicher Schock, weil ich der Beste war.
Margaret Bergmann – Lambert, ehemalige Spitzensportlerin wegen Ausschluss von der Teilnahme an den Olympischen Spielen
Bergmann schwor, dass sie auch nach Kriegsende nie wieder nach Deutschland zurückkehren würde, wenn zumindest der westliche Teil des Landes beginnen würde, den Weg der Demokratie einzuschlagen. Sie wollte sich mehrere Jahrzehnte lang nicht einmal mit den Deutschen auseinandersetzen. Erst 1996 änderte sie ihre Meinung. Sie folgte der Einladung des Deutschen Olympischen Komitees als Gast bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta, USA. „Ich habe beschlossen, dass ich dieser Generation von Deutschen nicht die Schuld für das geben kann, was ihre Väter und Großväter getan haben“, erklärte sie der New York Times.
Drei Jahre später willigte sie auch ein, nach Deutschland zu gehen, wohin sie berufen wurde, als das Laupheimer Stadion, in dem die Nazis ihr einst den Sport verboten hatten, nach ihr benannt wurde. Sie begründete ihre Teilnahme damit, dass junge Menschen, die nicht die Schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren tragen, auf die Schrecken der Vergangenheit aufmerksam gemacht werden sollten. „Ich hatte das Bedürfnis, mich selbst daran zu erinnern, also nickte ich mit dem Kopf zurück zu dem Ort, an den ich geschworen hatte, dass ich ihn nie betreten würde“, wurde sie damals von Jewish in Sports zitiert. Sie benannten auch eine Straße, die zum Berliner Olympiastadion führt, nach Bergmann.

Hardcore-Leser. Freundlicher Unternehmer. Hipster-freundlicher Internet-Befürworter. Stolzer Ernährungswissenschaftler. Extremer TV-Fan.